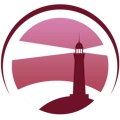Man sollte weder ständig mit, noch gegen den Strom schwimmen, sondern einfach mal aus dem Fluss klettern und eine Pause machen.
AUSGEBRANNT: WIE GEFÄHRLICH IST BURN OUT?
Was versteht man in der Medizin unter Burnout?
Im ICD-10 ist Burnout keine eigenständige psychische Erkrankung, sondern wird als Zustand, der bei Problemen mit der Lebensbewältigung auftritt, definiert. Burnout wird daher nicht als eigenständige Krankheit klassifiziert, sondern unter dem Diagnoseschlüssel Z73.0 („Ausgebranntsein: Burn-out, Zustand der totalen Erschöpfung“) geführt.
Wenn ein Patient oder eine Patientin neben den Symptomen von Burnout weitere psychische Erkrankungen wie depressive Episoden oder Angststörungen entwickelt, wird die jeweilige Krankheit diagnostiziert.
Geplant ist eine Neuerung: Im Gegensatz zur ICD-10 soll Burnout künftig in der neueren ICD-11 erstmals genauer definiert und als berufsbezogenes Phänomen klassifiziert (Code: QD85) werden. Leider ist weder in Österreich noch in Deutschland die ICD-11 bis jetzt verbindlich eingeführt und vollständig im klinischen Alltag implementiert. Die Umsetzung ist aber für die nächsten Jahre geplant.
Was ist Burnout in der Praxis?
Die Gefahr eines Burnouts entsteht durch eine Kombination aus persönlichen Risikofaktoren und externen Stressoren, besonders am Arbeitsplatz. Dazu gehören z.B. Zeitdruck, Arbeitsüberlastung, fehlende Motivation und mangelnde Wertschätzung. Aber auch Perfektionismus, zu hohe Ansprüche an sich selbst und die Schwierigkeit, Grenzen zu setzen, können zu chronischem Stress führen, der schließlich in Erschöpfung und Leistungsabfall bis hin zu gravierenden, psychischen Störungen wie Depression oder Panikattacken resultieren kann.
Was sind persönliche Risikofaktoren bei der Entstehung von Burnout?
Persönlichkeitsmerkmale: erhöhtes Verantwortungsbewusstsein und sehr hohe Ansprüche an die eigene Leistung, Schwierigkeit beim Grenzen setzen, Erfolgsorientierung
Innere Antreiber: Perfektionismus, hohes Harmoniebedürfnis, zu große Strenge mit sich selbst, immer für alle da sein wollen
Selbstwahrnehmung: Starker Idealismus, Vernachlässigung eigener Ziele, Unfähigkeit, Schwächen einzugestehen
Mangelnde Selbstfürsorge: Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse nach Ruhe, Pausen und Auszeit
Arbeitsplatzbezogene Risikofaktoren
Hohe Arbeitsbelastung: ständiger Zeitdruck und unerreichbare Ziele von Seiten des Arbeitgebers, häufige Überstunden
Mangel an Anerkennung: Fehlende Wertschätzung, Anerkennung oder Belohnung für die eigene Arbeit, häufige Kritik
Fremdbestimmtheit: zu wenig bis gar kein Einfluss auf die eigenen Aufgaben
Konfliktpotential: Streit mit Kolleg:innen, Ignoranz, Ungerechtigkeit, Mobbing
Soziale Faktoren: Mangelnder Teamgeist, zu wenig Ansprache Isolation
Was sind typische Anzeichen für Burnout?
Psychisch: Chronische Erschöpfung, verminderte Leistungsfähigkeit, Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Problemtrance, Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen; im schlimmsten Fall Depression, Angststörung oder Nervenzusammenbrüche.
Physisch: Bluthochdruck, Herzrasen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden, geschwächtes Immunsystem und in der Folge erhöhte Anfälligkeit für Infektionen, Muskelverspannungen, Rückenschmerzen, Schwindel, Tinnitus.
Energetisch: Energiemangel, Gefühl, innerlich leer zu sein, Vergesslichkeit.
Sozial: zunehmende Distanzierung, sozialer Rückzug, Isolation, Zynismus, negative Haltung gegenüber der Arbeit und Kolleg:innen
Findest du dich hier wieder? Bist du mit einem oder mehreren Risikofaktoren oder den Symptomen konfrontiert?
Melde dich hier zu einem kostenlosen Info-Gespräch an.
Wer ist besonders gefährdet, in ein Burnout zu kommen?
Der Begriff Burnout wurde 1974 von Herbert Freudenberger, einem Psychoanalytiker in New York, eingeführt. Er entdeckte dieses Beschwerdebild vor allem in sozialen Berufen, z.B. in der Pflege, wo sich die Menschen besonders empathisch engagieren, ohne dabei auf die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu achten. Es würde laut Freudenberger auch die Motivation fehlen, als Ausgleich etwas Freudvolles für sich selbst zu tun.
Zwar geht man auch heute davon aus, dass vor allem Menschen, die in medizinischen, sozialen und pädagogischen Bereichen tätig sind und viel mit anderen Personen arbeiten, (Pflegeberufe, Ärzt:innen, Lehrer:innen, Sozialarbeiter:innen, …) einem erhöhten Risiko, an Burnout-Symptomen zu erkranken, ausgesetzt sind. Dazu kommen aber mehr und mehr Angestellte im mittleren Management (Sandwich-Position), Selbständige und pflegende Angehörige.
Da aber die Bedingungen am Arbeitsplatz durch Ressourcenmangel (Zeit, Budget, Fachkräfte) insgesamt erschwert sind, fühlen sich viele Mitarbeiter:innen unter Druck gesetzt. Auch die zunehmende Digitalisierung hat – trotz aller unbestrittenen Vorteile- Auswirkungen auf den Wohlfühlfaktor im Beruf, besonders wenn Arbeitsprozesse überwacht werden, was zu einem Verlust der Motivation und Identifikation mit der Arbeit führt. Daher sind mittlerweile Angestellte in unterschiedlichen Berufsfeldern ebenso betroffen, ein Burnout zu entwickeln.
Wieso ist es so wichtig, Burnout rechtzeitig zu erkennen?
Wenn Klient:innen zu mir in die Praxis kommen, ist es aufgrund bestimmter Signale meist nicht schwer zu erkennen, dass jemand geradewegs auf ein Burnout zu spaziert. Das sind oft Sätze wie: „Ja, ich weiß, dass mir das alles zu viel ist, aber wer soll es denn sonst machen?“ Oder: „Ich kann doch meine Kollegin nicht im Stich lassen“. Bedrohlich wird es, wenn ich höre:
„Ich bin ständig müde, obwohl ich jeden Tag um 09:00 schlafengehe.“
„Ich komme mir vor wie ein Roboter, ich muss nur noch funktionieren.“
„Ich habe keine Freude mehr an meiner Arbeit. Zu Hause kann ich mich aber auch zu nichts aufraffen, nicht einmal, um mich mit Freunden zu treffen“.
Meistens erzählen die Klienten aber auch von psychosomatischen Problemen, wie Herzrasen, Schlaflosigkeit oder Kopfschmerzen.
Es ist sehr wichtig, Burnout rechtzeitig zu erkennen und anzusprechen. Es ist zwar nicht immer zielführend, Dr. Google zu befragen, aber als mündiger Patient ist man sehr wohl verantwortlich dafür, körperliche und geistige Symptome ernst zu nehmen und zu hinterfragen.
Wenn also typische Symptome wie Verdauungsprobleme, ständige Müdigkeit oder Schwindelgefühl nach 14 Tagen nicht verschwinden, oder es keine Erklärung dafür gibt, sollte man aus Eigenverantwortung heraus, einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. Die Diagnosestellung erfolgt dann ja meist aufgrund von Laborwerten, eventuell bildgebenden Untersuchungen, aber auch der Zuweisung zu einem Facharzt. Es können für die Symptome ja auch andere Faktoren verantwortlich sein.
Umgekehrt kann sich auch im Coaching-Prozess zeigen, dass die Klientin Burnout gefährdet ist. Oft versuchen die Klienten ja gerade in dieser Situation, vom Stress weg zu kommen, Blockaden abzubauen oder Ängste zu verarbeiten. So kann ich als Stress – und Burnoutpräventions-Coach tatsächlich früh genug prophylaktisch einen Einfluss nehmen.
Wie arbeite ich mit Burnout-Patienten?
Da sich hinter Burnout oft psychische Beschwerden verstecken, heißt die Antwort ganz klar: Der oder die Klient:in gehört in fachärztliche Betreuung, die z.B. auch mit Medikamenten verbunden sein kann.
Da ich Coach für Stress – Burnoutprävention bin, sehe ich es als meine Aufgabe, meine Klient:innen in einem Zustand abzufangen, wo Prävention eben noch Sinn macht. Es ist gerade dann extrem wichtig, auf seine inneren Kräfte und Ressourcen zugreifen zu können, Stress abzubauen und in einen Entspannungszustand zu kommen. Ich finde es wunderbar zu sehen, wie oft es gelingt, Menschen abzufangen, und sie davor zu bewahren, in einen Erschöpfungszustand zu geraten, aus dem sie sich selbst nicht mehr befreien können.
Deshalb arbeite ich vernetzt mit Ärztinnen und Ärzten, Energetikerinnen, Heilmasseuren und viele anderen Berufsgruppen, die eben vorbeugend daran beteiligt sind, dem Burnout entgegen zu wirken, und so das Schlimmste verhindern können.
Aber auch, wenn Patienten aus der Burnout-Phase heraußen sind, macht es Sinn, mit Mentalcoaching im stressfreien Zustand zu bleiben, um nicht wieder rückfällig zu werden.
Folgende Übungen und Methoden wende ich dabei an
- Visualisierungs – und Imaginationstechniken, die bewusst mit positiven Zielbildern arbeiten
- Verhaltenstraining
- Trance/Hypnose, wo das Unterbewusstsein angesprochen wird, um z.B. ein früheres Erlebnis zu verarbeiten oder einen destruktiven Glaubenssatz zu löschen
- Individuelle Entspannungstechniken und Verankerung der Entspannungszustände
- Gelassenheitstraining
Sobald ein Burnout oder eine begleitende Erkrankung diagnostiziert wird, gebe ich meine Klienten an ärztliche Kollegen ab, bleibe aber so gut wie immer mit ihnen in Verbindung, um danach unsere gemeinsame Arbeit im Coaching wieder aufnehmen zu können.
Wie kann man Burnout vorbeugen?
Wie im oberen Kapitel erwähnt, kann man durch aufmerksames Beobachten des eigenen Körpers und der persönlichen Stimmungslage sowie der Wahrnehmung einzelner Symptome das Risiko für Burnout erkennen.
Weitere Maßnahmen können sein:
Regelmäßige und systematische Selbstreflexion und Selbstgespräche:
Warum geht es mir zur Zeit nicht gut? Wann sind die Kopfschmerzen am stärksten? Was habe ich falsch gemacht (wenn sich immer wieder Schuldgefühle einstellen)?
Bewusste Entspannung und Erholung zur Förderung der Work-Life-Balance
Ressourcentraining:
Was steckt in mir? Womit kann ich mich stärken/gelassener werden?
Coaching:
Ob Mentaltraining, Stresscoaching oder Motivationstraining – man kommt immer einen Schritt weiter, wenn man unter Anleitung an sich arbeitet.
Wie kann man Burnout behandeln?
In erster Linie geht es darum, eine praktikable Lösung im Rahmen der individuellen Möglichkeiten und Erwartungen sowie den äußeren Rahmenbedingungen zu finden. Viele Burnout Betroffene steigen nach und nach in einen Veränderungsprozess ein, der ihnen völlig neue Wege eröffnet. Das braucht allerdings Zeit und kann wiederum sehr gut in einem Coaching-Prozess stattfinden, soferne der Patient wieder gesund ist.
Typische Maßnahmen:
Wie auch bei der Burnout-Prävention sind die Reflexion über die eigenen Erwartungen, eine realistische Zielprogrammierung und eine Verbesserung der Work-Life-Balance wichtige Kriterien für die Genesung von Körper und Seele.
In der Therapie wie auch im Stress-Coaching lernen die Klient:innen außerdem
Entspannungstechniken
Gesunde Lebensführung (Ernährung, Bewegung, Ruhephasen)
Entlastungsmöglichkeiten
Neuausrichtung von persönlichen Erwartungen und Ansprüchen
Therapeutische Unterstützung: ist immer eine sinnvolle Maßnahme, wenn man herausgefunden hat, was man braucht
Supervision – und Selbsterfahrungsgruppen: vor allem in medizinischen und sozialen Berufen
Weiterbildung:
Ob in der Persönlichkeitsentwicklung oder fachliche Fortbildung, das öffnet so gut wie immer neue Chancen und stärkt das Selbstvertrauen.
Bei einer manifesten psychischen Störung (zumeist Depression oder Angststörung) ist diese psychiatrisch/psychotherapeutisch und/oder medikamentös zu behandeln. Auch der Aufenthalt in einer Burnout-Klinik kann angezeigt sein. Dort finden unter anderem berufsbezogene Stressbewältigungs-Therapieprogramme statt.
Hilft Mentalcoaching auch den Angehörigen von Burnout-Betroffenen?
Ja, Mentalcoaching für Partner:innen oder Angehörige von Burnout Gefährdeten macht Sinn, weil auch dieser Zielgruppe ein besonderes Maß an mentaler Stärke abverlangt wird. Neben Techniken zur Entspannung, Hypnose und Selbstfürsorge sind vor allem Selbstmotivation und Abgrenzung ein Thema.